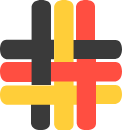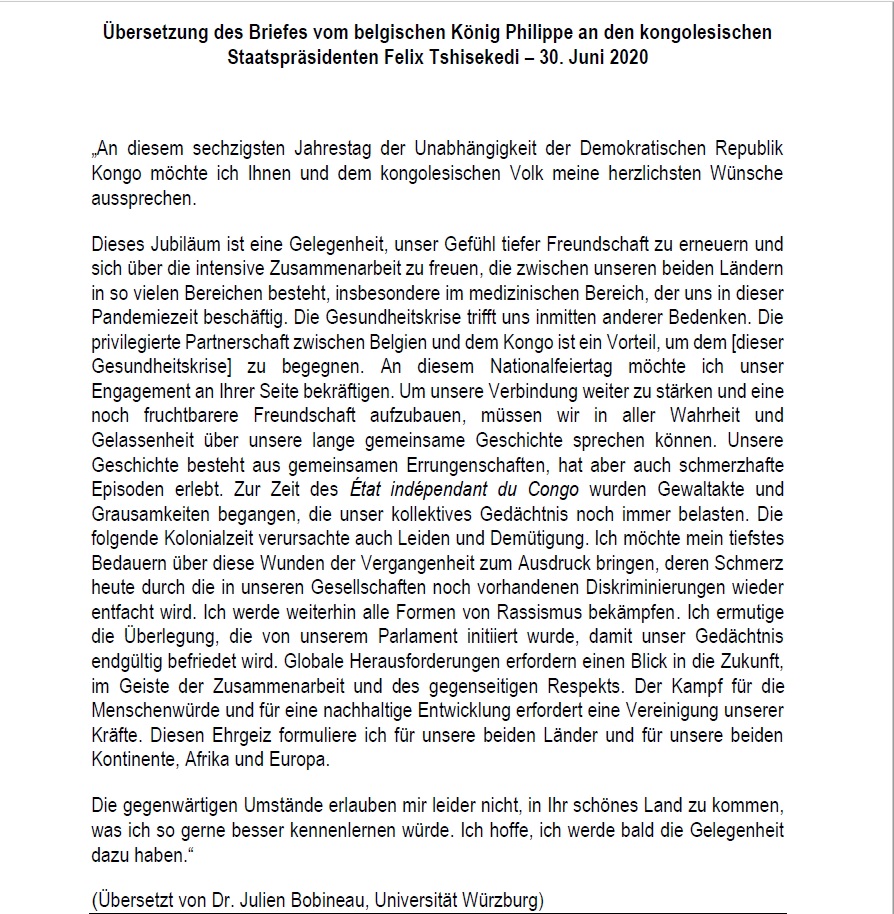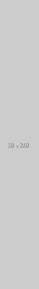Von Denkmalstürzen, Leopold II. und symbolischer Wiedergutmachung.
Die aktuelle Situation in Belgien. Ein Kommentar
- Von Dr. Julien Bobineau, Universität Würzburg -
Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA und den weltweiten Denkmalstürzen, die maßgeblich durch die Black Lives Matter-Bewegung initiiert wurden, haben sich auch in Belgien Stimmen erhoben, die gegen Rassismus, Neokolonialismus und eine unkritische Geschichtspolitik protestieren. Im Zentrum des Protestes steht mit Leopold II. eine durchaus ambivalente historische Persönlichkeit, die von 1885 bis 1908 als Alleinherrscher über den État indépendant du Congo regierte und diesen auf vielfältigen Ebenen kolonial ausbeutete. Zivilgesellschaftliche Vereinigungen wie die belgische Gruppierung Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations oder die kongolesische Organisation Lutte pour le Changement (LUCHA) fordern nun im Zuge der öffentlichen Proteste neben der Restitution von gestohlenen Kulturobjekten, dem Abtragen von kolonialen Denkmälern und der breiten Beschäftigung mit Kolonialgeschichte in Schulen und Universitäten insbesondere eine offizielle Entschuldigung von Seiten Belgiens. Die Gruppierung Réparons l’Histoire konnte innerhalb kurzer Zeit ca. 22.000 Unterschriften für eine Petition sammeln, die eine vollständige Entfernung aller Denkmaler von Leopold II. forderte. In der Folge führten Kommentator*innen, Politiker*innen und Aktivist*innen zahlreiche Debatten um koloniale Verantwortung in den Medien, während einige Leopold II.-Denkmäler im öffentlichen Raum im Zuge eines antikolonialen Vandalismus‘ beschädigt wurden: Aktivist*innen beschmierten das Reiterstandbild Leopolds II. an der Place du Trône in Brüssel mit Begriffen wie „Assassin“ (‚Mörder‘), während ein Königsdenkmal im Antwerpener Vorort Ekeren abgetragen werden musste, da Aktivisten die Leopold II.-Statue mit roter Farbe übergossen hatten, um symbolisch auf das Blutvergießen während der Kolonialzeit hinzuweisen. In der Parkanlage, die das AfricaMuseum im Brüsseler Vorort Tervuren umgibt, wurde eine Büste von Leopold II. rot eingefärbt und mit dem Graffiti „FDP“ für „Fils de pute“ (‚Hurensohn‘) versehen. Diese enorme Wucht des Protestes, der zwar bereits vorher existierte, durch die Ereignisse in den USA in Verbindung mit der weltweiten Black Lives Matter-Bewegung allerdings angefacht wurde und nun eine entsprechende Sichtbarkeit in der öffentlichen Debatte innehat, ist aus meiner Sicht direkte Konsequenz einer verfehlten belgischen Geschichtspolitik. Denn Belgien hat sich im öffentlichen Diskurs – mit einigen wenigen Ausnahmen wie der Entschuldigung des ehemaligen belgischen Premierminister Guy Verhofstadt in Kigali (2000) oder die Bitte um Vergebung, gerichtet an die Familie Patrice Lumumbas durch Außenminister Louis Michel im belgischen Parlament (2002) – bislang nicht ausreichend kritisch mit der eigenen Kolonialvergangenheit und den daraus resultierenden Auswirkungen in den ehemaligen Kolonien und in Belgien selbst auseinandergesetzt.
Doch der öffentliche Druck, der aus dem Protest der Zivilgesellschaft resultierte, führte in der Folge zu einem politischen Novum: In einem Brief an den kongolesischen Staatspräsidenten Felix Tshisekedi drückte der belgische König Philippe am 30. Juni 2020 – dem Jahrestag der kongolesischen Unabhängigkeit – sein tiefes Bedauern für das im Kongo begangene koloniale Unrecht aus. Es ist das erste Mal, dass sich ein belgisches Staatsoberhaupt aus dem Königshaus mit derartigen Worten an die kongolesische Bevölkerung richtet. Auch die belgische Premierministerin Sophie Wilmès sprach dem der Demokratischen Republik Kongo am selben Tag ihr Bedauern in Bezug auf die koloniale Vergangenheit Belgiens aus.
Eine nähere Betrachtung des Inhaltes kann allerdings dazu veranlassen, die Klassifizierung der Äußerung als Wendepunkt zu hinterfragen. Die zentrale Stelle des Briefes, die das koloniale Unrecht in Form von Besatzung, Unterdrückung, Mord, Versklavung, Vergewaltigung und Verschleppung thematisiert, wird aus grammatikalischer Sicht von Passivkonstruktionen und objektiven Substantivierungen dominiert: „Zur Zeit des État indépendant du Congo wurden Gewaltakte und Grausamkeiten begangen, die unser kollektives Gedächtnis noch immer belasten. Die folgende Kolonialzeit verursachte auch Leiden und Demütigung.“ Hier wird König Philippe ganz bewusst vermieden, direkte historische Verantwortung zu übernehmen, was aus rechtlicher Sicht nicht unerheblich ist, wenn es z. B. um die Forderung von Reparationszahlungen geht. Nichtsdestotrotz kann der Brief sicherlich als ein erster Meilenstein im komplexen Prozess der historischen Aufarbeitung von Kolonialgeschichte bezeichnet werden. Die Frage jedoch, ob die Haltung des belgischen Königs Philippe langfristig nachwirken und positive Veränderungen mit sich bringen wird, lässt sich erst retrospektiv in einigen Jahren beantworten.
Dennoch darf die Diskussion um koloniale Verantwortung mit dem Brief von Philippe nicht enden – ganz im Gegenteil: Die belgische Kolonialvergangenheit muss weiterhin öffentlich thematisiert und kontrovers diskutiert werden, um eine Grundlage für die vollständige Aufarbeitung des kolonialen Unrechts zu bilden. In der aktuellen Debatte ist es aus meiner Sicht unabdingbar, auf Augenhöhe diskutieren zu können und allen Beteiligten zuzuhören. Dies erfordert eine vorbehaltlose Diskussionsbereitschaft auf allen Seiten und ist im Hinblick auf eine verfassungsrechtlich verankerte Meinungsfreiheit die oberste Prämisse in einer pluralistischen Demokratie. Kritische Argumente mit einem Hinweis für fehlende Notwendigkeit oder übertriebene Political Correctness zu bekämpfen, kommt einer formalen Abwertung der Kritik gleich. Eine derartige Entwertung kritischer Meinungen, die dynamische Veränderungsprozesse anzustoßen versuchen, ist der politischen und kulturellen Unterdrückung während der Kolonialzeit nicht unähnlich, da das Hinterfragen von eurozentrischen Fremdzuschreibungen – in diesem Fall einer verhältnismäßig einseitigen Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur, die gewaltvolle Mechanismen der Kolonisation positiv im kollektiven Gedächtnis zu halten versuchen – durch die Bezeichneten kaum möglich ist. In Bezug auf Denkmäler, Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik muss man in Belgien wie überall anders auch jeden Einzelfall für sich betrachten. Ich bin jedoch grundsätzlich der Meinung, dass die Denkmäler nicht restlos abtragen werden dürfen – das betrifft selbstverständlich nicht diejenigen Fälle, die Menschen ganz offensichtlich rassistisch beleidigen –, sondern vielmehr durch korrekte Kontextualisierung eine historische und gegenwärtige Verortung erfahren sollten. Wenn ein Kolonialdenkmal einmal aus dem öffentlichen Raum abgetragen worden ist, dann verschwinden mit dem Denkmal nicht die kolonialen Denkmuster, die in Belgien wie auch im restlichen Europa vielfach noch vorherrschen. Unter diese Denkmuster fällt nicht zuletzt auch der vielfältig auftretende institutionelle Rassismus als Langzeitfolge einen kolonialrassistischen Aufteilung der Welt bis 1960: Debatten um alltägliche Diskriminierung, die Chancenungleichheit, rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling sind auch in Belgien im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung geführt worden. Als institutionellen Rassismus bezeichnet man strukturelle Formen von historisch gewachsener Diskriminierung, die innerhalb der Gesellschaft in Form von Gesetzgebung, staatlichen Institutionen, ethischen Normen und sozialen Handlungsweisen wirkt, ganz gleich, ob diese Diskriminierung bewusst oder unbewusst von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern praktiziert wird.
Im Gegensatz hierzu lehnen konservative Gruppierungen wie Mémoire du Congo oder Union Royale Belgo Africaine, ehemals Union Royale belge pour les pays d’Outre Mer) eine Revision der postkolonialen Geschichtspolitik ab. Ihrer kolonialnostalgischen Argumentation folgend habe Leopold II. als ‚humanistischer Philanthrop‘ den Weg für das ‚Licht der Zivilisation‘ und die Abschaffung der Sklaverei in Zentralafrika geebnet, während die belgische Kolonialverwaltung später mit dem Bau von Krankenhäusern und Straßen vorgeblich zu Wohlstand und Entwicklung im Kongo beigetragen habe. Die von Publizist*innen und Historiker*innen auf ca. 10 Millionen Opfer geschätzte Zahl derjenigen Kongoles*innen, die direkt oder indirekt während Leopolds II. Privatherrschaft an den Folgen des Kolonialismus starben, bezeichnen die genannten konservativen Gruppierungen in der aktuellen Debatte als ‚Fake News‘ (siehe den Offenen Brief eines Zusammenschlusses konservativer Vereinigungen in La Libre Belgique). Viele Kommentare in den Sozialen Medien bestärken das Gefühl, dass viele Belgier*innen die Infragestellung der Erinnerung an Léopold II. und die Kolonialzeit für überflüssig halten: Hashtags wie „PasEnMonNom“ (‚Nicht in meinem Namen‘) suggerieren dabei, dass der Ausdruck des Bedauerns von König und Regierung in Bezug auf das koloniale Unrecht nicht von der gesamten belgischen Bevölkerung getragen wird. Dennoch ist die kolonialkritische Äußerung durch König Philippe bislang einzigartig im Kontext der belgo-kongolesischen Beziehungen. Der Brief an den kongolesischen Präsident ist ebenso aus formaler Sicht ungewöhnlich, da die belgische Verfassung dem König enge Rahmenbedingungen hinsichtlich jedweder politischer Äußerungen setzt. Als Repräsentant des belgischen Staates muss die geäußerte Meinung des Königs mit der Überzeugung der Regierung übereinstimmen und darf dieser nicht widersprechen. Premierministerin Sophie Wilmès hat die nötige Konformität der Argumente des Königs in einer Rede am Nachmittag des 30. Juni 2020 im Brüsseler Stadtteil Ixelles/Elsene bestätigt.
Aufgrund der äußeren Form und der zugrundeliegenden Intention des Briefes ist an dieser Stelle sicherlich von einem Wendepunkt in der belgischen Geschichtspolitik zu sprechen.
Im Gegensatz zum individuellen Rassismus, der von Einzelpersonen ausgeht, erfolgt struktureller Rassismus meist latent durch eine entsprechend diskriminierende Auslegung von Gesetzen und Normen in Polizei (z. B. durch Racial Profiling), Behörden, Schulen, Universitäten oder auch in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und bei der Wohnungssuche (weiterführende Information unter diesem Link). Für internationales Aufsehen sorgte inmitten dieser Debatte der rassistische Übergriff von belgischen Polizeibeamt*innen auf die deutsche EU-Abgeordnete Pierette Herzberger-Fofana im Juni 2020.
Um diesen institutionellen Rassismus in Belgien effektiv bekämpfen und so einen erheblichen Beitrag zur Schaffung des sozialen Friedens leisten zu können, ist eine breite historische Aufklärung der Bevölkerung unerlässlich. Wichtig ist deshalb, dass Kolonialgeschichte als ‚Lehre kolonialer Unterdrückungsformen‘ – eben ohne das Narrativ der ‚philanthropischen Zivilisierungsmission‘ von Leopold II. und den belgischen Kolonialist*innen – in schulische und universitäre Lehrpläne einzieht und dort unverrückbar für die nächsten Generationen verortet wird. In Bezug auf die Debatte um Kolonialdenkmäler plädiere ich nach der Einzelfallprüfung folglich auch für eine kreative Veränderung der Statuen und Büsten bspw. durch Schwarze Künstler*innen. So bleibt Kolonialgeschichte im öffentlichen Raum präsent, wird durch künstlerische Veränderung aber hinterfragbarer und bietet eine Grundlage für Debatten um Verantwortung, Wiedergutmachung und sozialen Frieden. Denn anders als reaktionäre Stimmen vielfach behaupten, sind Geschichtspolitik und Erinnerungskultur keine statischen Parameter, sondern vielmehr dynamische Prozesse, die stetigen gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sind und ständig neu definiert werden müssen. Diese Dynamik der Neudefinition unserer historischen Werte und ideologischen Überzeugungen stellt aus meiner Sicht eine unverzichtbare Existenzgrundlage unserer freiheitlichen Demokratien dar. Im Juni 2020 hat das belgische Parlament die Einrichtung einer historischen Wahrheitskommission beschlossen, die sich mit der belgischen Kolonialgeschichte beschäftigen soll. Die Aufarbeitung des Kolonialismus wird Belgien demnach noch einige Zeit beschäftigen.